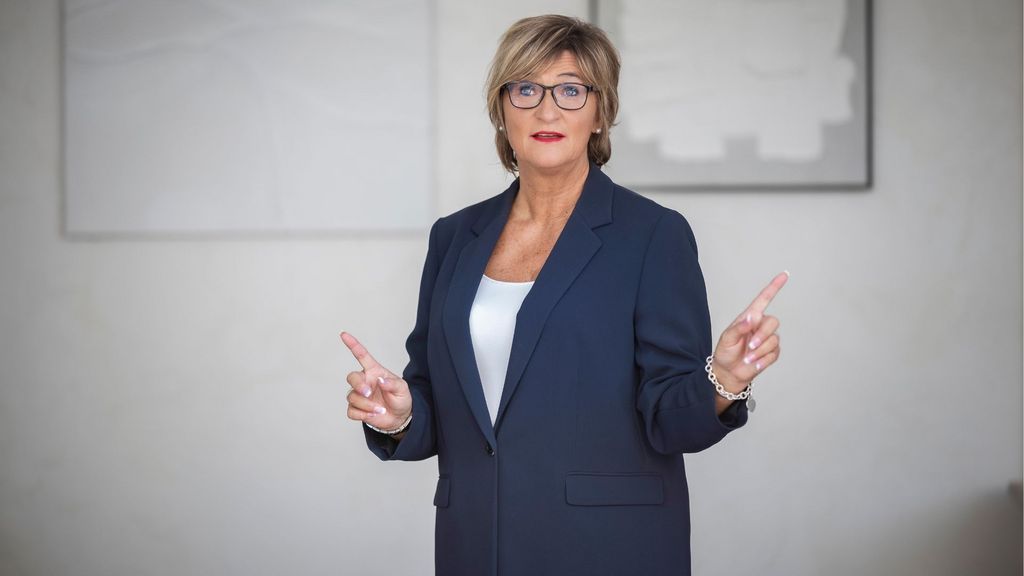Einige Beispiele aus der Praxis
Teilzeitregelungen nach der Klage gegen das Arbeitszeitkonto: Nach der gewonnenen Klage gegen das vom damaligen Kultusminister Michael Piazolo 2020 eingeführte Arbeitszeitkonto weiß niemand, wie es weitergeht. Denn das Kultusministerium hat gegen das Urteil eine Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt und kündigte an, das Arbeitszeitkonto "tragfähig und rechtssicher" überarbeiten zu wollen. Nur wann? Schulleitungen wissen nicht, wie sie planen sollen, Lehrkräfte wissen nicht, was sie in den Teilzeitanträgen einreichen dürfen, können oder sollen. Nach der Aussage des Kultusministeriums soll nach dem Gerichtsurteil jetzt Zeit gewonnen werden, neue Regelungen zu finden. Die Schulen brauchen aber Lösungen! Die Lehrerinnen und Lehrer warten auf ein umfassendes und machbares neues Modell des Arbeitszeitkontos – und faire Angebote für die Kolleginnen und Kollegen, die nachweislich unfair behandelt wurden.
Verbesserungen für Fach- und Förderlehrkräfte: Wo bleiben die Verbesserungen für diese beiden Gruppen? Viele Male hat die Kultusministerin hier Versprechungen gemacht - und wann kommt jetzt was? Der BLLV fordert unter anderem konkrete Schritte bei Beförderungsmöglichkeiten, endlich Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen, die Umsetzung dezentraler Ausbildungsstätten und weitere Qualifizierungsmöglichkeiten.
Lehrkräftemangel: Wie geht es hier weiter? Was wird gemacht? Das offizielle Anerkennen des bestehenden Lehrkräftemangels alleine reicht nicht. Das Prinzip der Freiwilligkeit, gerade bei einer möglichen Aufstockung der Stunden von Teilzeitbeschäftigten – wie unter anderem vom Ministerpräsidenten zur Bewältigung des Lehrkräftemangels gefordert – muss bestehen bleiben. Sonst kann den Lehrerinnen und Lehrern niemand mehr die Wertschätzung durch die Politik vorgaukeln. Statt den Lehrenden aber attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten, wird in den Grund-, Mittel- und Förderschulen immer noch unter den Bedingungen des sogenannten „Piazolo-Pakets“ gearbeitet. Neben dem oben erwähnten Arbeitszeitkonto wurden die Antragsaltersgrenze angehoben, arbeitsmarkpolitische Teilzeitmöglichkeiten eingeschränkt und damit auch das sogenannte Sabbatmodell gestrichen. Die Folge: Begrenzte Dienstfähigkeiten und Dienstunfähigkeiten nehmen zu – die Lehrkräfte können nicht mehr. Dieser Schnellschuss von 2020 bleibt bis heute bestehen. Nun sind auch andere Schularten auf dem Weg zu bedrohlichem Lehrkräftemangel. Es muss dieses Mal ein transparentes, gerechtes Modell mit Weitsicht gefahren werden.
FiLBY (Fachintegrierte Leseförderung Bayern) und ByLES (Bayerischer digitaler Lesetest): Durch die sehr schnelle Einführung von ByLES zu Schuljahresbeginn mussten Lehrkräfte teilweise sowohl die sehr zeitaufwändigen FiLBY- als auch die ByLES-Selbstlernkurse zeitgleich zu Schuljahresbeginn absolvieren. Auch die Schulleitungen und die Administratoren von „BayernCloud Schule“ hatten hier alle Hände voll zu tun, um die nötigen Zugänge und Voraussetzungen zu schaffen, damit ByLES überhaupt durchgeführt werden konnte. Ganz zu schweigen von denjenigen, die die ganzen Sommerferien durcharbeiten mussten, um die Selbstlernkurse und die nötigen technischen Grundlagen überhaupt erst zu erstellen. Lehrkräftegesundheit sieht anders aus.
Sprachstandserhebungen: Der Ministerpräsident hat es verkündet und die betroffenen Ministerien mussten innerhalb kürzester Zeit reagieren. Die „Absprache“ zwischen diesen Ministerien ergab: Das Kultusministerium ist für das Personal, die Methode und die Räumlichkeiten verantwortlich. Die Testmöglichkeiten sind jetzt einsetzbar und die Beratungsfachkräfte werden bald darauf geschult. Zur Anwendung bleiben aber viele Fragen offen: Wie soll ein so großes Projekt innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden? Bei Dienstbesprechungen mit Beratungsfachkräften herrscht Ratlosigkeit. Es muss „halt einfach irgendwie funktionieren“. Ist das professionelle Bildungspolitik? Erreicht das das Ziel? Alles wurde mit der heißen Nadel gestrickt und die Grundschulen müssen vieles ausbaden, weil verlässliche Informationen und Mustervorlagen nicht rechtzeitig vorliegen. Die Beratungsfachkräfte sollen während der Tests vom Unterricht freigestellt werden. Fällt dann der Unterricht aus? Nein, selbstverständlich machen die Kolleginnen die anfallenden Stunden „einfach auch noch nebenbei“. Mobile Reserven: Fehlanzeige! Mehrarbeit für die Kolleginnen und Kollegen Jawoll! So kann’s nicht gehen! Oder war das dann eben doch nur ein politischer Vorschlag des Ministerpräsidenten, der ganz gut in die Zeit der scharfen Migrationspolitik passt?
Entbürokratisierungsinitiative: Begrüßenswert, aber das Ergebnis ist noch offen und bislang kommt bei den Lehrerinnen und Lehrern noch keine Entlastung an. Hat die Ampel auf Bundesebene ausgedient, so sind es jetzt die Ampelfarben grün, gelb und rot, die die 500 Maßnahmen einordnen, die zur Entbürokratisierung vorgeschlagen wurden: Was ist machbar (grün), was kann man diskutieren (gelb), was geht gar nicht (rot). 80 Prozent dieser Maßnahmen sollen bis Ende der Legislatur umgesetzt werden, so die Kultusministerin. Aber was wäre denn wirklich entlastend – beispielsweise für die Schulleitungen? Werden wirklich Entlastungen geboten oder werden bürokratische Prozesse nur verschoben? Dann machen es halt am Ende die Verwaltungsangestellten an der Schule. So kann es nicht gehen!
Digitalpakt: Welche Kommunen sind in der Lage, nachhaltig zu finanzieren? Werden die Bundesgelder wirklich abgerufen? Wie sehr beherrscht das Thema den Bund, die Länder und die Kommunen? Wir kritisieren: Eine Absprache zwischen den einzelnen Ebenen muss dringend her!
„Migrationsteiler“: Ab 25 Schülern wird eine Klasse „geteilt“, wenn im Jahrgang mehr als 50 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund haben. Jedes Jahr wieder erwarten die Schulen gespannt, wie viele Stunden es für die geteilte Klasse dann gibt. Denn klar ist: Eine Klasse zu teilen geht nur dann, wenn die Schule mindestens 19 Lehrerstunden bekommt. Im August/September wird aber erst bekannt, wie viele Stunden es gibt. Im aktuellen Schuljahr waren es vielfach nur vier Stunden. Das ergibt aber leider keine geteilte Klasse, sondern da kann die Klasse vier Stunden pro Woche eine zweite Lehrkraft bekommen. Für die Öffentlichkeit gibt es den Migrationsteiler, de facto aber sind Lehrende und Lernende im Stich gelassen.
Bildungspolitik braucht Tiefgang und echte Verantwortung
„Wir müssen weg von der Ankündigungspolitik und hin zu echten und machbaren Verbesserungen. Wenn ich mir die Lehrkräftegesundheit auf die Fahnen schreibe, aber die Lehrerinnen und Lehrer am Ende in sinnlosen Aus- und Fortbildungen verheize, sie ‘zig Vertretungen machen müssen, sich in Fortbildungen tummeln, die vorgeschrieben, aber nicht umsetzbar sind, dann verliere ich an Glaubwürdigkeit. Wir brauchen Fokussierung und Schwerpunkte in der Bildungspolitik. Und wir brauchen eine Priorisierung von Zielen, die dann auch entsprechend dieser Priorisierung angegangen und umgesetzt werden. Ohne Schwerpunkte, ohne jemanden, der in die Führung geht, und ohne eine Orchestrierung der Bildungspolitik wird sich am Ende gar nichts ändern – zumindest nicht zum Besseren“, so die BLLV-Präsidentin.